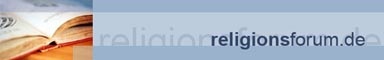30-04-2008, 16:56
Zum Thema islamische Expansion :
Zitat:Prof. Albrecht Noth
Die arabisch-islamische Expansion
(Albrecht Noth, geb. 1937, war Professor für Islamwissenschaft und Arabistik am Seminar für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients an der
Universität Hamburg.)
(futuh = Eroberung/en)
Als charakteristisch für die arabisch-islamische Expansion sind immer wieder ihre ungewöhnliche Schnelligkeit ebenso wie ihre anscheinend unaufhaltsame Stetigkeit hervorgehoben worden.
Schon ein kurzer Blick auf die – übrigens nicht immer ganz sichere – Chronologie der wichtigsten Resultate muslimischer Eroberungstätigkeit ist allerdings beeindruckend: Ausgehend von ersten muslimischen Einfällen ins persisch-sassanidische Südmesopotamien und ins byzantinisch kontrollierte
Südpalästina in den Jahren 633/34 wird bereits 635 Damaskus eingenommen ; bald danach – möglicherweise in ein und demselben Jahr (636) – schlagen muslimische Formationen massive byzantinische und persisch-
sassanidische Aufgebote vernichtend und entscheidend,
erstere am Jordan-Nebenfluß Yarmūk, letztere bei Qâdisiyya (westl. von Nadschaf/Irak); der Sieg bei Qâdisiyya führte letztlich zur baldigen Einnahme der sassanidischen Hauptstadt Ktesiphon/arab.: al-Madâ‘in,
mit dem Erfolg am Yarmūk wird Syrien/Palästina de
facto muslimisch, die Eroberung der Hafenstadt Caesarea/Qaysariyya (zw. Haifa und Jaffa) 640 nimmt den Byzantinern den letzten Außenposten in ihrer ehemaligen Provinz ; in den Jahren 639–642 unterwerfen
sich die Muslime Ägypten, ein späterer (645/46) Versuch der Byzantiner, Alexandrien zurückzugewinnen, scheitert letztlich ; fast gleichzeitig mit der Eroberung Ägyptens, etwa in den Jahren 640–642, kommt nahe-
zu ganz Persien unter muslimische Kontrolle.
Entscheidend dürfte die Niederlage eines sassanidischen Heeres bei Nihāwand (im Zagros, südl. von Hamadân) gewesen sein (wohl 642) ; dem folgen in den vierziger und fünziger Jahren die Eroberungen von Südost-Iran und Nord/Ost-Iran (im wesentlichen das Gebiet von Chora-
san) ; von Ägypten aus führen, um 650 beginnend, fortlaufende Unternehmungen zur allmählichen Islamisierung Nordafrikas, wichtiger Standort wird das um 670 gegründete Kairuan/al-Qayrawân (heute Tunesien), die letzten Byzantiner verlassen um 700 Nordafrika (Kar-
thago) ; in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre werden
die Muslime – mit der entscheidenden Hilfe »abtrünniger« byzantinischer Experten – auch zur See aktiv, 649 können sie Zypern erobern, 655 vor der kleinasiatischen Küste eine byzantinische Flotte vernichten, 652 und 667
Angriffe auf Sizilien unternehmen ; 672 sah sich Konstantinopel selbst zum ersten Mal einer muslimischen Belagerung gegenüber ; bereits 652 war auch Armenien erobert worden, im gleichen Jahr hatten Vorstöße von
Ägypten aus nach Nubien zu einer Art muslimischer
Kontrolle auch über dieses Gebiet geführt ; das Jahr 711
markiert den Beginn der weitesten muslimischen Vorstöße in die – von Medina aus gesehen – Himmelsrichtungen (Süd-) Ost und (Nord-)West :
In diesem Jahr erscheinen muslimische Truppen einerseits zum ersten
Mal auf dem indischen Subkontinent (im Sind/Südindus-Gebiet), während ein Jahr später von Chorasan aus die für die weitere islamische Geschichte so bedeutsame Eroberung Transoxaniens einsetzt ; andererseits
setzen die Muslime 711 von Nordafrika (Tanger) aus
nach Spanien über und schlagen den letzten Gotenkönig (Roderich) entscheidend ; in den folgenden zwei bis drei Jahrzehnten gelang es dann bekanntlich, nahezu die gesamte Iberische Halbinsel und (zeitweilig)
größere Teile Südfrankreichs unter muslimische Kontrolle zu
bringen ; das christliche Abendland beginnt eine »Sarazenen«-Gefahr zu spüren ; hundert Jahre nach dem Tod des Propheten muß (732) ein – wohl eher »Razzia«-artiger – Vorstoß der »Sarazenen« in Richtung Loire
von Karl Martell in der Gegend zwischen Tours und Poitiers aufgehalten werden : Der nicht mehr genau zu lokalisierende Platz des Treffens verbindet sich in der abendländischen Geschichtsbetrachtung mit der endgültigen Bannung einer großen Gefahr, in der islamischen Geschichtsüberlieferung nennt er sich »(Befestigte) Straße der (Krieger-)Märtyrer (balât aš-šuhadâ‘)« ;
von muslimischer Seite aus gesehen sehr viel schwerwiegender und ernüchternder war allerdings die, trotz großen Aufwandes erfolglose, zweite und für sehr lange Zeit letzte Belagerung von Byzanz in den Jahren 715–
718 gewesen. Ganz allgemein läßt sich zur Mitte des achten Jahrhunderts hin ein Abflauen muslimischer Eroberungs-Aktivität verzeichnen ; die Befestigung und – nicht immer erfolgreiche – Verteidigung der erreichten
Grenzen tritt zunehmend in den Vordergrund.
Es ist verständlich, daß man sich immer wieder um Erklärungsmodelle für diese frappierend schnellen und weiträumigen Eroberungs-Erfolge der Muslime im ersten islamischen Jahrhundert bemüht hat.
Diese Suche nach den Ursachen hat m. E. bisher vor allem zweierlei
ergeben : Zum einen sind alle Deutungsversuche wenig überzeugend, die die Rolle des Islam als neue Lebensund (in weitestem Sinne) politische Ordnungsform dabei minimieren oder als Faktor gar ausklammern wollen, zum anderen wird man sich von eher monokausalen Erklärungen weg auf die Annahme und in vielem noch zu leistende Erforschung einer – alles andere als unkomplizierten – Polykausalität hin zu bewegen haben. […]
Die historischen Voraussetzungen für die ersten – so entscheidenden – Erfolge muslimischer tribaler Gruppen außerhalb der Arabischen Halbinsel waren in den dreißiger Jahren des siebten Jahrhunderts ohne Zweifel
äußerst günstig.
Im Norden und Nordosten, wo im übrigen geographische Barrieren (zumindest für Araber) nicht vorhanden waren, befanden sich weitestgehend unbefestigte und immer schon durchlässige Randgebiete von entfernten Provinzen der beiden Großreiche (Byzanz, Iran der Sassaniden-Dynastie), die schließlich – ersteres in wesentlichen Teilen, letzteres insgesamt – der muslimischen Eroberung zum Opfer fielen.
Diese beiden seit langem konkurrierenden Imperien hatten zudem bis kurz vor dem Erscheinen muslimischer Formationen auf ihrem Territorium im Kampf um die Herrschaft über Syrien erschöpfende Kriege miteinander geführt und waren im hier entscheidenden Zeitraum auch innerpolitisch alles andere als stabil.
Ernsthafte – und vor allem schnelle – Reaktionen auf die ersten lokalen Erfolge der Muslime mögen gerade auch aus diesen Gründen nicht erfolgt sein.
Wesentlicher allerdings scheint eine Fehleinschätzung (Unterschätzung)
des Gegners gewesen zu sein, die jedoch den seinerzeit
Verantwortlichen kaum anzulasten ist : An ephemere
Überfälle arabischer tribaler Gruppen auf die jeweiligen Randzonen im Süden (Byzanz) und Osten/Südosten (Iran) war man seit langer Zeit gewöhnt, sie waren lästig, stellten aber keine essentielle Gefahr dar.
Die ersten muslimischen Angriffe hatten nun – gerade auch
aus der Ferne gesehen – den traditionellen »Razzia«-Charakter ; daß sie im Zusammenhang mit einer gänzlich neuen politischen Konzeption standen, war nicht sofort zu erkennen ; als die Gefahr dann in ihrem ganzen Ausmaß deutlich wurde und die beiden Großreiche mit massiven Aufgeboten reagierten – die beiden schon kurz erwähnten Schlachten am Yarmūk und bei Qâdisiyya (wohl 636) markieren hier den Höhepunkt und aufgrund der muslimischen Siege auch schon den Anfang vom Ende –, war der entscheidende Zeitpunkt für eine erfolgreiche Abwehr bereits verpaßt, zu fest schon hatten sich die Muslime in ihren Zielreligionen
etablieren können.
Wenn wir die muslimische Seite der ersten futūh-Erfolge betrachten, so erscheint zunächst als wesentlicher Faktor die Tatsache, daß es […] offenbar gelang, tribale Gruppen in den Randzonen für eine – zunächst wohl
nur als lokal und zeitlich begrenzt gedachte – Zusammenarbeit zu gewinnen, für gemeinsame Aktionen also, deren Ziele nicht genau festgelegt waren, die aber den miteinander Verbündeten aufgrund der wechselseitigen Stärkung erfolgversprechend erschienen (und ja auch er-
folgreich waren) und bei denen muslimischerseits das Bekenntnis der Partner zum Islam nicht unbedingt als Voraussetzung für die Zusammenarbeit verlangt wurde.
Unter diesen Partnern der Muslime scheinen vor allem auch tribale Gruppen gewesen zu sein, die theoretisch »in Diensten« der Großreiche standen, nämlich – im Rahmen von deren bewährter Politik, ihre Grenzen vor Arabern durch Araber schützen zu lassen – gegen ein Entgelt Überfälle von Süden kommender Stämme und Clans abzuwehren hatten.
Die tribalen Gruppen in den Randzonen – ob nun von den Großreichen abhängig oder nicht – hatten mit Sicherheit von der Konstituierung des umfangreichen Bündnissystems […] erfahren ; ihre teilweise Bereitschaft zur Zusammenarbeit dürfte eine Ausrichtung nach dem Erfolg gewesen sein ;
den Muslimen jedenfalls verhalf sie wesentlich zur Besetzung erster wichtiger Positionen in Syrien/Palästina und am Euphrat.
Die Abmachungen zwischen den muslimischen Eroberern, welch letztere man sich – zumindest in den ersten Jahrzehnten – nicht so sehr als geordnete Heere, sondern eher als eine Vielzahl von recht selbständig agierenden tribalen Einheiten vorzustellen hat, und Stammesgruppierungen in den Grenzregionen mit dem Ziel gemeinsamer Unternehmungen, ohne daß von denMuslimen das (sofortige) Bekenntnis der Kooperationswilligen zum Islam eingefordert wurde, lassen bereits in den Anfängen eine Verhaltensweise der Eroberer erkennen, die außerordentlich weitreichende Konsequenzen haben sollte : ihre Bereitschaft (und Fähigkeit) zum Kompromiß und Arrangement.
Eine muslimische Ökumene – so läßt sich hier schon generalisierend feststellen – ist wesentlich durch Vereinbarungen und Verträge zustandegekommen und nicht durch eine praktizierte Missionskriegs-Mentalität.
Den Muslimen ist anscheinend sehr schnell deutlich geworden, daß die autochthone Bevölkerung in den Regionen ihrer ersten Vorstöße zu großen Teilen wenig Grund und Neigung zur Loyalität gegenüber den Repräsentanten der jeweiligen politischen Ordnungen hatte, in die sie eingebunden war, daher auch keine großen Anstrengungen unternahm,
diese ernsthaft zu verteidigen.
Der Grund hierfür ist vor allem in bereits seit langer Zeit schwelenden und zum Teil erbittert ausgetragenen Religionskonflikten zwischen Provinzbevölkerung und herrschender Staatsgewalt zu suchen ; dies gilt vornehmlich für die byzantinischen Gebiete, trift aber zum Teil auch auf das sassanidische Iran zu.
Die Christen in Syrien/Palästina und Ägypten (Kopten) gehörten überwiegend monophysitischen Glaubensrichtungen des Christentums an, waren damit im Sinne der »orthodoxen« (chalkedonischen)
byzantinischen Staatskirche Häretiker und seit langem erheblichen Pressionen ausgesetzt ; im westlichen Iran gab es große Gruppen von (nestorianischen) Christen und von Anhängern anderer Religionsgemeinschaften, die mit dem staatstragenden Zoroastrismus nicht
in Einklang standen. Eine politische Neuorientierung, möglicherweise ein Wechsel in der Herrschafft, konnten daher großen Teilen der autochthonen Provinzbevölkerung in Syrien/Palästina und im Irak durchaus als
attraktiv erscheinen, falls sie sich unter Voraussetzungen vollzogen, die eine Verbesserung ihrer Lebensumstände versprachen.
In dieser Situation war es nun von höchster Bedeutung, daß die allmählich vordringenden Muslime von der eingesessenen Bevölkerung in den Provinzen der Großreiche durchweg Unterwerfung, nicht aber Konversion zum Islam verlangten ; zwar erging muslimischerseits in der Regel eine Aufforderung zur Islam-Annahme (da‘wa), aber die Konsequenzen einer Ablehnung waren
nun eben nicht muslimische Versuche, einen Religionswechsel mit kriegerischen Mitteln zu erzwingen.
Man hatte es nämlich während der futūh vornehmlich mit
»Schriftbesitzern« zu tun.
Mit »Schriftbesitzer«-Gruppen auf der Arabischen Halbinsel hatte sich bereits der Prophet verschiedentlich vertraglich geeinigt, und in
Sure 9,29 war offenbart worden, daß diese zu bekämpfen
seien, bis sie eine Abgabe (ğizya) entrichten ; und diese
war in Art und Höhe nicht festgelegt, somit gab es weiten Verhandlungsspielraum.
Da nun die Muslime schon sehr bald über die distanzierte bis feindselige Haltung der ihnen begegnenden Provinzbevölkerung gegenüber ihren Staatsgewalten informiert gewesen sein dürften (entsprechende Hinweise scheinen z. T. von Repräsentanten der Bevölkerung selbst gekommen zu sein), bestimmte zunehmend mehr die ğizya-Alternative der koranischen Offenbarung ihr Verhalten, während die dort viel stärker betonte Aufforderung zum Kampf – ğizya eher als »ultima ratio« ! – in den Hintergrund rückte.
Es entwickelte sich die für die muslimischen Eroberungen so typische und für ihren Erfolg so entscheidende Vertragspraxis der Eroberer, der bei aller Verschiedenheit der Abmachungen das einfache Schema zugrundelag :
Die Muslime erhalten Abgaben (eben : ğizya) – ihre Vertragspartner erhalten Schutz (dimma), dies bei wechselseitiger Abhängigkeit der Konditionen. […]
Die Muslime auf der Basis derartiger Verträge, die wohl fast durchweg schriftlich fixiert worden sind, als neue Oberherren zu akzeptieren, fiel großen Teilen der betroffenen Bevölkerung offensichtlich nicht allzu
schwer, zumal nachdem abzusehen war, daß die Muslime Herr der Lage bleiben würden und Sanktionen der möglicherweise zurückkehrenden früheren Staatsgewalten kaum mehr zu befürchten waren : Die ausge-
handelten Abgaben dürften des öfteren niedriger als die vordem abzuführenden Steuern gewesen sein ; die anfängliche Unerfahrenheit der Muslime in diesen Dingen erwies sich hier als günstig.
Wesentlicher aber war die muslimische Schutzgarantie für die freie Religionsausübung, eine Garantie, an die sich die Eroberer fast durchweg strikt hielten, auf Einschränkungen nur dort insistierten, wo die praktische Ausübung des Fremdkultus der eigenen Religionspraxis störend oder belästigend in den Weg trat.
Religionsfreiheit hatte aus den eben genannten Gründen für viele der von der muslimischen Eroberung betroffenen Untertanen der beiden zentralistischen Großreiche bis dato nicht bestanden, der Herrschaftswechsel brachte somit in einem wesentlichen Bereich erhebliche Vorteile, ja die muslimischen Eroberer wurden mitunter regelrecht als Befreier begrüßt. […]
Die muslimische Vertragsbereitschaft und Vertragspraxis, legitimiert durch prophetische Präzedenz und göttliche Offenbarung, darf man als die entscheidende Basis betrachten, auf der die futūh überhaupt erst mög-
lich wurden. […]
Nur durch die auf Vereinbarungen beruhende Unterstützung von Seiten der Einwohner in den futūh-Regionen ließ sich überhaupt die gesamte Logistik der muslimischen Unternehmungen bewältigen : Verpflegung, Gastung, Führerdienste, Kundschafteraufgaben u. ä. sind denn auch die Dienstleistungen, die in den Verträgen immer wieder begegnen, und manches davon scheint sogar unter der – inhaltlich unbestimmten – ğizya rubriziert worden zu sein.
Diese gesamte unentbehrliche, ja überlebensnotwendige, Basis-Unterstützung wäre den muslimischen Eroberer-Gruppen mit Sicherheit nicht zuteil geworden, wenn sie mit dem Konzept einer auf
kriegerischem Wege zu erreichenden Zwangsbekehrung zum Islam angetreten wären.
Der Einsicht der Muslime in diese Notwendigkeiten ist es wohl auch zuzuschreiben, daß sie im Laufe der futūh den Personenkreis, der
durch die koranischen Offenbarungen als »Schriftbesitzer« definiert und infolgedessen – darauf kam es hier an – vertragsfähig auf der ğizya – Schutz/dimma-Grundlage war, erheblich erweitert haben.
Hatte man es anfänglich noch in überwiegendem Maße mit »Schriftbesitzern« im koranischen Sinne, nämlich Christen (vor allem) und Juden zu tun, so begegnete man bei den weiteren Vorstößen nach Osten vor allem Anhängern des Zoroastrismus (arab. : magűs).
Auch diese wurden nun als »Schriftbesitzer« qualifiziert, womit der Zwang
entfiel, sie wie »Götzendiener« unter allen Umständen zum Islam zu bekehren, und sich die Möglichkeit eröffnete, mit ihnen zu vertraglichen Vereinbarungen zu kommen, eine Möglichkeit, von der die muslimischen
Heerführer dann auch ausgiebig Gebrauch gemacht haben.
Das hier so deutlich sichtbar werdende Bestreben der muslimischen Eroberer, sich die für eine dauerhafte Sicherung ihrer Erfolge und für weitere Verstöße unerläßliche Vertrags-Option – durchweg verbunden mit
dem Zugeständnis der Religionsfreiheit – offenzuhalten, belegt besonders eindrucksvoll die Argumentation eines muslimischen Heerführers, der im Sind/Südindus-Gebiet (zu Beginn des achten Jahrhunderts) mit
Buddhisten einen Vertrag abschloß und ihnen dabei die
Unverletzlichkeit ihres Buddha-Heiligtums garantierte:
»Ein Buddha-Tempel ist (ja schließlich) nichts anderes als die Gotteshäuser der Christen und Juden und die Feuer-Heiligtümer der Zoroastrier (magűs).«
Nun hat natürlich die Vertragsbereitschaft der muslimischen Eroberer nicht ausgeschlossen, daß es im Verlauf der futūh auch immer wieder zu Kämpfen mit der jeweils einheimischen Bevölkerung gekommen ist.
Die Muslime hatten ihre militärische Stärke, sei es in Gefechten, sei es bei der Belagerung von festen Plätzen, des öfteren erst einmal zu demonstrieren, bevor ihre nichtmuslimischen Kontrahenten zu der Überzeugung kamen, daß eine vertragliche Einigung mit den Muslimen
für sie die vorteilhafteste Lösung sei.
Auch erforderte gelegentlicher Vertragsbruch von seiten der unterworfenen Nicht-Muslime kriegerische Interventionen.
Doch es konnte eben auch sehr häufig auf den Einsatz kriegerischer Mittel verzichtet werden, zumal nachdem die überraschend günstigen Unterwerfungs-Konditionen zunehmend mehr bekannt geworden waren und
sich die Tatsache herumgesprochen hatte, daß sich die
Muslime in der Regel an ihre Vereinbarungen hielten.